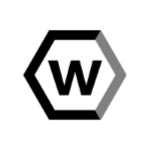Wem die Stunde schlägt …
Geschichte der Weltliteratur in einer Stunde – ein Buch mit diesem Titel vorzulegen, dazu bedarf es sicherlich einer gewissen Kühnheit, um nicht zu sagen Dreistheit. Vor einiger Zeit entdeckte ich das 111 Seiten umfassende Buch aus dem Jahre 1921 in einem Antiquariat und erstand es gerade dieser kühnen Ironie wegen.1
Der Verfasser: Klabund, ohne Vorname. Wie ich herausfand, ein Pseudonym, eine Kombination aus ,Klabautermann’ und ,Vagabund’, für Alfred Henschke (1890 – 1928). Er verfasste zahlreiche seinerzeit erfolgreiche Dramen und Romane und übersetzte aus dem Chinesischen, Japanischen und Persischen.
Das programmatische Motto, das Klabund dem Werk voranstellt, ist ein Goethezitat: „Wenn wir Deutschen nicht aus dem engen Kreise unserer eigenen Umgebung hinausblicken, so kommen wir gar zu leicht in einen pedantischen Dünkel. Ich sehe mich daher gern bei fremden Nationen um und rate jedem, es auch seinerseits zu tun.“
Die Tendenz des Werks ist liberal und pazifistisch, philosemitisch und antinationalistisch, pro Völkerverständigung, gegen politischen Extremismus von rechts wie von links. (Es enthält trotzdem die eine oder andere saftige ,politische Unkorrektheit’; welche, sage ich nicht).
Es ist eine amüsante Lektüre, Klabunds Stil ist journalistisch, und er verwendet auch die üblichen journalistischen Präsentationstechniken: einprägsame Beispiele, Vermengung von Biographischen und Literarischem, kurze charakteristische Zitate aus den Werken der behandelten Autoren (Autorinnen fehlen fast ganz), überraschende Fakteninformationen, hemdsärmelige Wertungen.
Kaum ein Leser dürfte nachher behaupten, tief ins Herz der Weltliteratur eingedrungen zu sein; zu vieles ist holzschnittartig, teilweise grob entstellend. Das Kapitel über die römische Literatur etwa ist alles andere als tiefschürfend, es enthält – etwa im Hinblick auf die schnoddrige Abwertung der Aeneis („nicht besonders originell“) – krasse Fehleinschätzungen.
Wer Gefallen an geschliffener Boshaftigkeit hat, kommt in jedem Fall auf seine Kosten; ein paar beliebige Beispiele, vielfach fortsetzbar:
Pindar, einer der größten Lyriker der griechischen Antike, dichtete über die Wettkämpfer der olympischen Spiele, „und er besang ihre Siege nicht anders als heute die amerikanischen Jazzlyriker die Boxer Dempsey und Carpentier besingen“ – eine Aussage, die er danach doch differenziert.
Über Shakespeares Gedicht Venus and Adonis: Missgünstige behaupteten, „es wäre die Lieblingslektüre der elisabethanischen Dirnen. Was nur für diese sprechen würde.“
Pierre Ronsard wollte, so Klabund, mit seiner Franciade seiner Heimat ein Nationalepos schenken, „der Ilias würdig. Was ihm nicht geglückt ist.“
Figaros Hochzeit von Beaumarchais könnte auch „der Polterabend der Revolution heißen“.
Über Prosper Merimée: „Die weibliche Endung (ée) seines Namens findet eine Parallele in einer stark weiblich betonten Komponente seines Wesens, die so weit geht, daß er weibliche Pseudonyme (Hyacinta Maglanowich) wählt und dem einer spanischen Tänzerin zugeschriebenen Buch sein Porträt als Spanierin mit der Mantille anhängt.“
Gabriele d’Annunzio „rühmt sich, ein Lateiner zu sein, und erkennt in jedem Menschen von fremdem Blut einen Barbaren. (Was ihn nicht hinderte, einmal einen Barbaren namens Nietzsche anzuoden und anzuöden, ohne den er ,nichts wäre’.) Er ist ein politischer Charlatan, ein Poseur mit einem genialen Einschlag.“
Legte ein Erfolgsautor heutzutage ein solches Buch vor, er stünde im Handumdrehen im Shitstorm, und zwar aus folgendem Grund: Alle möglichen sich nicht gewürdigt fühlenden Minderheiten – und noch dazu: das ganze weibliche Geschlecht! – würden mit schrillen Posaunenstößen die Qual ihres Diskriminiertseins kundtun. Die Grünen würden wahrscheinlich hergehen und die gesetzliche Einführung verbindlicher Quotenregeln für solche Gesamtdarstellungen fordern! Kurzum: vorbei sind die Zeiten, wo man, wie in der Weimarer oder der Bonner Republik, meinen und schreiben konnte, was man wollte.
Klabund jedenfalls machte es nichts aus, weder bei den Eskimos2 noch in Lateinamerika noch in Afrika fündig geworden zu sein: für ihn anscheinend allesamt literaturgeschichtliche Totalausfälle.3 China, Japan, Persien, Ägypten dagegen werden, in dieser Reihenfolge, ausführlich gewürdigt, wie auch andere außereuropäische Literaturen, beispielsweise die der USA.
Am Ende der Lesestunde verbleibt nicht nur eine Menge einprägsamer Details, sondern auch eine Vorstellung von Weltkultur, ganz im Sinne des genannten Goethezitats. Gewiss kann hier jeder vielfältige Leseanregungen finden.
1 Mein Exemplar entstammt der zweiten, vom Autor neu durchgesehenen Auflage, Leipzig 1923.
2 Ich wähle die ältere Bezeichnung ,Eskimos’, da auch ,Inuit’ inzwischen ins Visier der politisch Korrekten geraten ist; vgl. das Werk Populäre Irrtümer über Sprache von O. Ernst, J. C. Freienstein und L. Schaipp, Stuttgart 2011, S. 112 ff. Der einzige jetzt noch mögliche Weg, die Eskimos/Inuit sprachlich nicht zu diskriminieren, ist demnach – das Schweigen.
3 Im Falle Afrikas würdigt er allerdings die letzten römischen Autoren, wie Apuleius, und die brasilianische Literatur bedenkt er mit einem Satz als Abschluss des Kapitels ,Portugal‘.