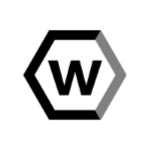Ein Renaissancegespräch über Sprachen und Sprache
von Christoph Wurm – Dieser Aufsatz wurde erstmalig veröffentlicht im Mitteilungsblatt des Deutschen Altphilologenverbands, Landesverband Nordrhein-Westfalen, Heft 2/2017, S. 19 27.
Im Venedig des Jahres 1542 erscheint ein ,Dialogo delle lingue’, der nicht nur damals und dort großes Aufsehen erregte, sondern Fragen aufwirft, die auch uns heute beschäftigen.
Seit ein paar Jahren ist der Text leicht zugänglich in einer ausgezeichneten französischen Edition1, zweisprachig (Französisch – Italienisch).
Der Verfasser, Sperone Speroni, geboren im ersten Jahr des 16. Jahrhundert, gestorben 1588, im Jahre des Untergangs der spanischen Armada, war Schriftsteller, Philosoph, Diplomat. Bereits in jungen Jahren Professor für Logik in Padua, verfasste er Gedichte, Studien zu Vergil, Dante und Ariost, zahlreiche Dialoge über die verschiedensten Themen sowie eine Seneca folgende Tragödie, ,Canace’, 1546. Er galt als „le maître de la nouvelle littérature en langue vulgaire“ (S. XIII).
An der fiktiven, aber den realen Standpunkten der Beteiligten entsprechenden Diskussion, die er 1530 in Bologna situiert, beteiligen sich der Dichter Pietro Bembo, der damals mit seinem Werk ,Prose della volgar lingua’ (1525) zu einer Instanz in Sachen Sprachkultur geworden war, Lazaro Bonamico, Professor für Altphilologie in Padua, sowie zwei nicht namentlich genannte Teilnehmer: ein Cortegiano vom päpstlichen Hof in Rom und ein Student.
Sie diskutieren über den Rang des Lateinischen und den der Volkssprache in Italien, denn eine Selbstverständlichkeit ist „in die Krise geraten“, „die Selbstverständlichkeit nämlich, daß die Universalsprache Latein in höheren Diskursuniversen verwendet wird, in der Dichtung, in der Gelehrsamkeit, in der höfischen transregionalen Konversation.“2
An Speronis Parteinahme für die Volkssprache besteht kein Zweifel, aber in seinem Dialog enthält er sich jeder eigenen Wertung.3 Daher hat Speroni auch den neutralen Titel ,Dialogo delle lingue’ gewählt, im Unterschied zu Joachim du Bellay. Als dieser ein paar Jahre später, 1549, Speronis Dialog als Anregung für ein eigenes Werk verwendet und Teile des Gesprächs Wort für Wort überträgt – ohne Speronis Namen zu nennen –, nennt er seine Schrift ,Défense et Illustration de la Langue française’.
Speroni lässt die unterschiedlichen Positionen fair zur Geltung kommen. „[D]ans le dialogue aucun personnage n’est dépositaire de la vérité et aucun n’est l’incarnation de l’erreur.“ (XXV) [In dem Dialog ist keine Person Treuhänder der Wahrheit und keiner die Inkarnation des Irrtums.] Ein Einigung wird nicht erzielt, aber keiner der Teilnehmer geht als Sieger aus dem Gespräch hervor.
Als erstes erfahren wir: Lazaro Bonamico ist von der Signoria Venedigs als Professor für die alten Sprachen an die Universität Padua geholt worden; sein Salär: dreihundert Goldscudi! Kein Zweifel besteht an seiner Haltung im Sprachenstreit. Die Volkssprache ist ein von Barbaren übel malträtiertes Latein, ein hässliches Kauderwelsch, „una indistinta confusione di tutte le barbarie del mondo“ (S. 9), die Hinterlassenschaft einer Welle von Einfällen barbarischer Völker in das römische Reich: Hunnen, Goten, Vandalen, Langobarden (S.9). Alle Versuche, ihn vom Gegenteil zu überzeugen scheitern an seiner steinernen Intransingenz.
Unfreiwillige Ironie, und zwar doppelt. Zum einen liegen zu diesem Zeitpunkt, 1530, längst die größten Werke der italienischen Literatur vor, von der Göttlichen Komödie zu den Sonetten Petrarcas, vom Decamerone zu der kühl-analytischen Prosa des Machiavelli. Zum anderen trifft diese Verunglimpfung mutatis mutandis nicht nur das Italienische, sondern auch die anderen romanischen Sprache (vor allem: das Französische, ,Fränkische’), eine Auswahl von Sprachen also, die in der Gegenwart gerade als besonders klang- und ausdrucksvoll gelten.
Pietro Bembo, der sich in seinen Schriften des Lateinischen4 genauso versiert bedient wie des Toskanischen, verteidigt das Dichten in der Volkssprache. Deren edelste Form ist für ihn das Toskanisch Petrarcas und Boccaccios – nicht die Sprache Dantes, dessen Toskanisch sei nicht rein genug: „la lingua di Dante sente bene e spesso più del iombardo che del toscano; e ove è toscano, è più tosto toscano di contado che di città.“ [die Sprache Dantes schmeckt recht häufig mehr nach Lombardisch als nach Toskanisch, und wo sie toskanisch ist, ist sie eher Bauerntoskanisch als urban.] (S. 25)
Die beiden Vorbilder der italienischen Literatur gelte es genauso zu studieren wie die lateinischen Humanisten und die Autoren der Antike. Italien habe eine eigenständige Kultur und Sprache hervorgebracht. Seinem Kontrahenten schleudert er die rhetorische Frage entgegen, ob wirklich alles Gegenwärtige wertlos sei:
„Le case, i tempii e finalmente ogni artificio moderno, i disegni, i ritratti di metallo e di marmo non sono da esser pareggiati agli antichi: dovemo però abitare tra’ boschi, non dipingere, non fundere, non isculpire, non sacrificare, non adorar Dio?“ (S. 13)
[Häuser, Gotteshäuser, ja jedes moderne Kunstwerk – Bilder, Porträts in Metall und Marmor – kommen ihren antiken Gegenstücken nicht gleich: Sollen wir aber deshalb wirklich in Wäldern hausen, aufhören zu malen, Statuen zu gießen oder zu meißeln, zu opfern, Gott anzubeten?]
Ganz anders sieht der Höfling die Sprachenfrage. Speroni versieht ihn aus gutem Grund nicht mit einem Namen, denn er vertritt die Ansichten einer ganzen sozialen Schicht. Philologisches kümmert ihn nicht. Die Novellen Boccaccios etwa, so sagt er, wirkten primär nicht durch ihre sprachliche Form, sondern durch die „natura delle cose descritte.“ (S. 7)
Bembo hält dem entgegen, Vergil, Homer, Boccaccio verlören in der Übersetzung in eine andere Sprache ihren Reiz, seien nicht mehr in der Lage, beim Leser ihre „Wunder zu wirken“ (non faranno questi miracoli) (S.8). Das ist derselbe Gedanke, den Jahrhunderte zuvor Beda Venerabilis (672/673 – 735) formuliert hat: „neque enim possunt carmina, quamvis optime composita, ex alia in aliam linguam ad verbum sine detrimento sui decoris ac dignitatis transferri (Hist. Eccl. Gent. Angl. IV, 24). Bei Beda ist aber die
Argumentationsrichtung genau umgekehrt – er verteidigt so die Eigenart muttersprachlicher, angelsächsischer Dichtung und meint deren Übersetzung ins Lateinische!5
Der Cortegiano weiß um die große Macht von Sprache, Sprache ist für ihn ein reines Kommunikationsmittel, das es möglichst effizient zu handhaben gilt. Dazu gehört etwa die Rhetorik oder die Fähigkeit, sich in höfischer Geselligkeit elegant auszudrücken. Ein versierter, raffinierter Sprecher will der Höfling sein, kein Sprachkünstler. Sein Motto: „vivere romano, parlare romano e scrivere romano.“ (S. 43). Er will sich dabei durchaus
bei anderen italienischen Dialekten bedienen, wenn ihm ein Wort oder eine Redewendung treffend erscheint. Toskanisch, noch dazu veraltetes, zu sprechen ist ihm zuwider, provokativ stellt er die Frage: Soll ich etwa nochmal zur Welt kommen, dieses Mal als Toskaner, wenn ich gutes Italienisch schreiben möchte? („Dunque, se io vorrò bene scrivere volgarmente, converrami tornare a nascer toscano?“) (S. 25).
„Fortiter in re, suaviter in modo“ ist eine Devise, die dieses Gespräch nur unvollkommen trifft, statt ,fortiter’ sollte es eher ,fortissime’ heißen. Hart prallen die Gegensätze aufeinander, nachdem die Samthandschuhe formaler Höflichkeit abgestreift sind – so hart, dass sich die Frage stellt, ob nicht in einem realen Gespräch an der einen oder anderen Stelle der Abbruch der Unterhaltung erfolgt wäre.
Der Scholar hat bisher bescheiden geschwiegen. Schließlich bittet der Höfling ihn um eine Stellungnahme. Er verweigert sie, aber erwähnt ein Gespräch zwischen seinem Lehrer, dem aristotelischen Philosophen Pietro Pomponazzi, und dem Gräzisten Janos Laskaris einige Jahre zuvor, anlässlich eines Besuches des in Frankreich lehrenden Byzantiners in Bologna.
Bei Pomponazzi hatten schon Bonamico und Speroni selbst studiert. Laskaris (Ἰᾶνος Λάσκαρις) war einer der Gründungsväter der Gräzistik. In einem 1557 in Antwerpen veröffentlichten Werk heißt es über ihn: „Graecorum fere omnium, qui Othomanicis armis patria pulsi in Italiam confugerunt, nobilissimus atque doctissimus fuit“. (vgl. S. XXXVII)
Ihr Gespräch gibt der Scholar nun in direkter Rede wieder, eine Technik der Dialogeinbettung, die an die Zuschaltung von Experten in Fernsehsendungen erinnert.
Mit zwei Argumenten kritisiert Pomponazzi den Gebrauch des Lateinischen und Griechischen in der zeitgenössischen Philosophie. Zum einen würden Menschen, die philosophieren wollten, in die Zwangsjacke der alten Sprachen gezwängt. Sie müssten unter hohem Zeitaufwand Sprachen lernen statt zu philosophieren, wären dann in den Sprach- und Denkmustern der Antike befangen. Zum andern meinten gute Lateiner oder Graezisten, sie seien deshalb auch Philosophen: wortgewandte Ignoranten.
Die besten Lebensjahre würden durch das Sprachenlernen vertrödelt, nicht der ingegno, nur die memoria werde geschult. Widernatürlich – „contra la naturale inclinazione del nostro umano intelletto“ (S. 38) – sei es, Mühe auf Worte statt auf Sachen zu verwenden. Besser wäre es, zu den Sachen vorzudringen, ein Echo der Worte Sokrates’ in Platons
Kratylos: μαθεῖν ἄνευ ὀνομάτων τὰ ὄντα [das Seiende ohne Worte erkennen]. (438e)
Die Beschäftigung mit den alten Sprachen sei zwar in der Gegenwart, solange nicht alles übersetzt sei, unumgänglich, aber eine unerfreuliche Notwendigkeit. Ihre Beherrschung sei „degna veramente non d’invidia ma d’odio, non di fatica ma di fastidio, e degna finalmente di dovere essere non appresa ma ripresa dalle persone, sì come cosa la quale non è cibo ma sogno e ombra del vero cibo dell’intelletto. (S. 38) [nicht des Neides, sondern des Hasses würdig, ja sie verdient es sogar, von den Menschen nicht erworben, sondern getadelt zu werden, so wie eine Sache, die nicht Nahrung, sondern Traumbild und Schatten der wahren Nahrung des Geistes ist.] Leidenschaftliche Worte, den griechischen Anteil an den geschilderten Qualen aber hat Pomponazzi selber nie durchlitten, er hat nie Griechisch gelernt (S. 31f.).
Für Fremdsprachler hat Pomponazzi Tröstliches parat: ein unterdurchschnittliches Gedächtnis reiche zum Erlernen von Sprachen völlig aus, irgendeine Begabung (ingegno) sei dazu sowieso unnötig (S. 38).
Nur eine Welt und nur ein Wissen von der Welt gebe es, und es sei belanglos, in welcher Sprache man diese Wahrheit ausdrücke. Er beruft sich dabei auf Aristoteles. Zu Beginn
Von Περὶ ἑρμηνείας/De interpretatione schreibt dieser:
Ἔστι μὲν οὖν τὰ ἐν τῇ φωνῇ τῶν ἐν τῇ ψυχῇ παθημάτων σύμβολα, καὶ τὰ γραφόμενα τῶν ἐν τῇ φωνῇ. καὶ ὥσπερ οὐδὲ γράμματα πᾶσι τὰ αὐτά, οὐδὲ φωναὶ αἱ αὐταί· ὧν μέντοι ταῦτα σημεῖα πρώτων, ταὐτὰ πᾶσι παθήματα τῆς ψυχῆς, καὶ ὧν ταῦτα ὁμοιώματα πράγματα ἤδη ταὐτά.
[Unsere Äußerungen sind Symbole für das, was unserer Seele widerfährt, und die Schrift symbolisiert wiederum die gesprochene Sprache. Und wie nicht alle Menschen dieselben Schriftzeichen verwenden, so sind auch ihre Sprachen verschieden. Die zugrundeliegenden seelischen Erlebnisse aber, für die mündliche und schriftliche Äußerungen Zeichen (σημεῖα) sind, sind bei allen Menschen dieselben, und auch die Gegenstände (πράγματα) von denen unsere Erlebnisse Abbilder sind.]
Für Laskaris sind Denken und Sprache untrennbar: „Diverse lingue sono atte a significare diversi concetti, alcune i concetti d’i dotti, alcune altre degl’indotti.“ [Verschiedene Sprachen sind dazu geeignet, verschiedene Begriffe zu bezeichnen, einige die Begriffe der Gebildeten, andere die der Ungebildeten.] Das Griechische eigne
sich ganz besonders für die Wissenschaft. (S.36)
Pomponazzi kritisiert, dass das Latein der Humanisten nicht lebe, da sie es aus den Werken der griechischen und römischen Klassiker zusammensetzten (S. 41). Am Ende des Dialogs nimmt der Höfling diesen Gedanken auf und wählt dabei den Vergleich mit den Trümmern einer Ruine (S. 43). Hier verbirgt sich der Stoff für eine zweite Normdiskussion, diesmal nicht über das Volgare, sondern darüber, welches Latein verwendet werden soll. Sie wird aber von den Beteiligten nicht geführt, weil für sie als Humanisten feststeht, dass nur ein Latein in Frage kommt, das den klassischen Vorbildern entspricht, also in der Tat Wort für Wort den Klassikern entstammt.
Dieses Normproblem ist von Josef Pieper im Vergleich mit dem mittelalterlichen Latein dargestellt worden. Er beruft sich dabei auf Christine Mohrmann, die dieses Latein „une langue vivente, sans être la langue d’une communauté ethnique“ nennt. [eine lebende Sprache, ohne die Sprache einer ethnischen Gemeinschaft zu sein]. Erst der Sieg des Klassizismus macht Latein zur toten Sprache. „Das Schlimme am Humanisten-Latein ist, daß es das Sprechen vom Leben trennt, und zwar auch vom Leben des Gedankens.“ Das Latein der Scholastik dagegen ist die lebendige Sprache der Wissenschaft.6
So pragmatisch Pomponazzi in allem argumentiert – ein Argument für das Lateinische muss er zu entkräften versuchen, das er gerade von dieser pragmatischen Warte aus anerkennen müsste: Das Lateinische ist die europäische Gelehrtensprache, wer international wirken will, muss Latein verwenden. Ihm fällt dazu nur die patriotische Aufforderung ein, italienische Philosophen sollte sich um Anerkennung zuhause bemühen, ohne sich darum zu scheren, was man in Deutschland oder anderen Ländern von ihnen halte. (S. 42). Hier findet also eine Diskussion statt, „ob die Universalsprache Europas aufgegeben werden soll, also sozusagen gerade das Gegenteil dessen, was uns heute bewegt, die wir uns gerade so eilfertig der neuen Universalsprache unterwerfen.“7
Ein Blick vom Ende her auf das Werk als Ganzes zeigt: das beste Argument ist eins, das keiner nennt. Die stärkste Begründung für die Vollwertigkeit des Italienischen als Kultur- und Wissenschaftssprache liefert Speronis Text selbst. Alle Beteiligten bedienen sich höchst eloquent der ,Volkssprache’ und bringen ihre Standpunkte wirkungsvoll zur Geltung. Das gilt auch für Bonamico, dem die von Hunnen verhunzte Volkssprache so zuwider ist, dass er – so Bembo – besser Latein spricht als Volgare (S. 13).
Wie zu erwarten finden sich im Text zahlreiche gelehrte Anspielungen auf antike Literatur, Geschichte und Mythologie; manche davon sind höchst gesucht. Lazaro
Bonamico: Wer die Volksprache schöner finde als Latein sei ein König Midas, dem die Flöte des Pan schöner in den Ohren geklungen habe als die Leier Apolls (S. 19).
Die Pointe – dass Midas zur Strafe Eselsohren, „aures lente gradientis aselli“ (Ovid, Met. XI, 179), verpasst bekommt – braucht Bonamico seinen belesenen Zuhörern gar nicht zu liefern. Sofort räumt der Höfling gerne ein, seine Ohren seien in dieser Hinsicht orecchie d’asino. Speroni will uns signalisieren: der (besser: ein) Cortegiano ist mit der antiken Literatur wohlvertraut.
Der Cortegiano ist es auch, der die rätselhafteste Anspielung beisteuert. Wer die Ruine Latein zu stützen suche, werde darunter zusammenbrechen wie Polydamas (S.43). Ein Blick ins Lexikon8 zeigt, dass er nicht den Waffengefährten Hektors meint, sondern einen thessalischer Kraftprotz, der bei dem Versuch ums Leben kam, mit seinen muskulösen Armen eine einstürzende Berghöhlendecke zu stützen.
Poetischen Glanz verleiht dem Text die Verwendung der Allegorie. Allegorisch verkleidete Argumente werden von einem Sprecher eingeführt, von einem anderen weitergesponnen und zugleich in die Gegenrichtung umgebogen. So schildert Laskaris (S. 38f.) etwa eine Vision, die er gehabt habe, als er den Worten seines Gesprächspartners lauschte: Mutter Philosophie, madre filosofia, habe weinend zwischen lauter Handwerkern gesessen, die in den hässlichsten Akzenten über eine Übersetzung des Aristoteles ins Lombardische diskutiert hätten. Sie habe über Aristoteles gejammert, der mit seiner These, man könne in jeder Sprache philosophieren, dafür verantwortlich sei. Der habe ihr geantwortet, er habe sie nie verletzen wollen und sei selbstverständlich Grieche – aus Brescia oder Bergamo stamme er nicht!
Pomponazzi kontert: Wäre ich dabeigewesen, hätte ich ihr gesagt, dass das vielsprachige Philosophieren ihr zu Ehre gereicht. Und wenn die Philosophie auch in der Lombardei präsent sein will, darf sie sich nicht darüber beklagen, dass man lombardisch philosophiert. (S. 39). Der Hinweis auf die Handwerker (er nennt Lastenschlepper, Bauern, Bootsfahrer) zeigt, dass die Forderung nach Verwendung des Volgare die Chance der Verbreitung, nach Demokratisierung des Wissens eröffnet. In einer neueren Arbeit9 ist dies zu Unrecht mit dem Hinweis bestritten worden, er spreche stets primär von den Gelehrten (dotti). Pomponazzi jedenfalls sagt: Die Philosophie hat keinen Grund zu trauern „perché ogni uomo, per ogni luogo, con ogni lingua il suo valore essaltasse“. [weil (in der Vision) jeder Mensch, an jedwedem Ort, in jeder Sprache ihren Wert rühmt.]
Nach der Einblendung des zweiten Dialogs schließt das Ausgangsgespräch. Der Höfling sieht sich durch das Gehörte voll bestätigt („infinite grazie“, S. 43). Bonamico: beklagt habe Pomponazzi die Notwendigkeit, die alten Sprachen zu lernen, geleugnet nicht! Bembo betont, dass zwischen Pomponazzi und Laskaris von Philosophie die Rede gewesen sei, nicht etwa vom Sprachgebrauch in Rhetorik und Dichtung.
Vieles von dem, was da diskutiert wird, ist auch heute von Belang, etwa die Frage nach einer gültigen deutschen Sprachnorm. Während Stilkolumnen und –bücher über korrektes Deutsch auf großes Interesse stoßen, streckt die germanistische Fachwissenschaft hier häufig kampflos die Waffen10, ist aber andererseits sofort bereit, gendergerechte und politisch korrekte Sprachregelungen zu übernehmen und zu exekutieren. Dann das Problem, wie – und in welchem Ausmaße – man die eigene Sprache gegenüber der Weltsprache Englisch behaupten kann und soll. Und: die Frage nach dem Verhältnis zwischen Sprache und Denken, einem philosophischen Dauerthema11. Im Lateinunterricht: inwieweit der Genuss etwa der Geschichten des Ovid tatsächlich auch auf Deutsch (und damit ohne Anstrengung) zu haben ist.
Anmerkungen:
1 Zitate aus dem Dialogo delle lingue nach der Ausgabe von Mario Pozzi (zweisprachig Französisch – Italienisch), Paris (Les Belles Lettres), 2009. Die römischen Zahlen beziehen sich auf die Seiten der Einleitung des Herausgebers M. Pozzi, die arabischen auf den Text des Dialogs.
2 J. Trabant, Europäisches Sprachdenken. Von Platon bis Wittgenstein. München 2006, S. 87.
3 In seinem Werk La vita e le opere di Sperone Speroni, Empoli 1920, S. 61, vertritt Francesco Cammarosano ohne nähere Begründung die These, Bembo sei Speronis Sprachrohr, „in tutto e per tutto“.
4 Als Vierundzwanzigjähriger hielt er 1494 eine handschriftlich überlieferte Rede in exzellentem Griechisch, die für die Förderung des Studiums des Griechischen warb.
5 Vgl. C. Wurm. „Die Sprachen des Beda Venerabilis“, in: Forum Classicum 4/2012, S. 290 – 296.
6 J. Pieper, Hinführung zu Thomas von Aquin. Freiburg im Breisgau 1967, S. 95f.
Der Aufsatz, auf den er sich beruft: „Le dualisme de la Latinité médiévale“, in: Revue des Études Latines 29 (Paris 1951). Das Zitat daraus auf S. 338.
7 Trabant, a.a.O., S. 87.
8 Der Kleine Pauly. Hrsg. von K. Ziegler und W. Sontheimer. München (dtv) 1979, Bd. 4, xs.v. Polydamas, S. 992f.
9 So J. Robert in Pluralisierungen: Konzepte zur Erfassung der Frühen Neuzeit (Pluralisierung & Autorität, Band 21). Hrsg. von J.-D. Müller, W. Oesterreicher und F. Vollhardt. Berlin/New York
2010. S. 66.
10 Vgl. etwa O. Ernst, J. C. Freienstein und L. Schapp, Populäre Irrtümer über Sprache, Stuttgart 2011. Die Autoren weisen jede Forderung nach Sprachpflege – etwa nach der Vermeidung von Anglizismen – entrüstet als Eingriff in die natürliche Entwicklung des Deutschen zurück.
11 Ein Thema, das auch die Öffentlichkeit interessiert, wie der internationale Erfolg des Bestsellers von Guy Deutscher, Through the language glass – Why the world looks different in other languages, New York 2019, beweist.
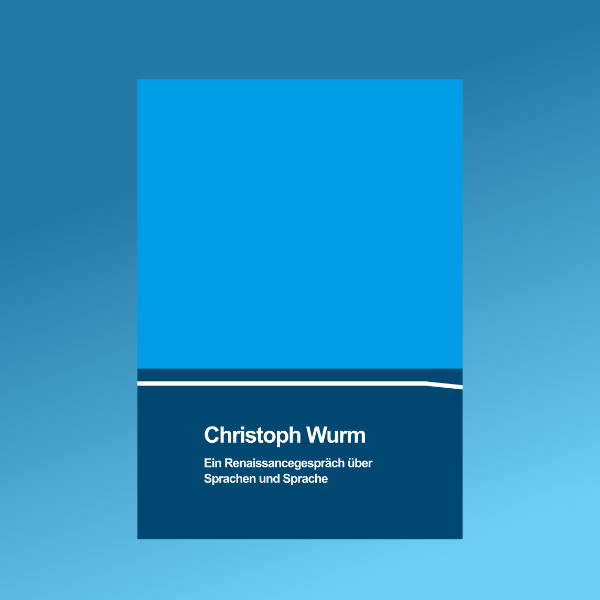
Dieses Dokument stelle ich Ihnen gerne kostenlos als PDF Dokument zum download. Um dieses Dokument herunterzuladen klicken Sie bitte auf den nachfolgenden Button.