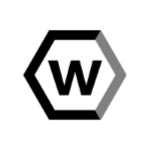Ovid, Vater Rumäniens
von Christoph Wurm – Der Aufsatz erschien in FORUM CLASSICUM Heft 2/2021
Der Titel dieses Aufsatzes – Theodor Haeckers ,Vergil, Vater des Abendlandes‘ nachempfunden – ist gewiss eine plakative Kurzformel, aber er soll die besondere Beziehung der Rumänen zu Ovid auf einen Nenner bringen.
Ovidiu
Wer ,Ovidiu‘ in eine Internet-Suchmaschine eingibt, wird feststellen, dass sich die große Masse der Fundstellen nicht auf den Schöpfer der Metamorphosen, sondern auf unzählige rumänische ,Namensvettern‘ bezieht, so beliebt ist Ovidiu als männlicher Vorname. Nicht nur das. Man wird bei dieser Recherche auf Stadt und Insel bei Constanța stoßen, die – eine nicht nur in Europa unübliche Form der Ehrung – beide den Namen des Dichters tragen. Jedes rumänische Geschichtsbuch, ob für Erwachsene oder für Jugendliche, enthält einen ausführlichen Hinweis auf Ovid, angereichert durch Zitate aus seinem Werk – eben nicht aus den Metamorphosen, sondern aus den Tristia und den Epistulae Ex Ponto.
Diese besondere Verbundenheit Rumäniens und der Rumänen mit dem Dichter hat unterschiedliche Gründe. Zunächst: Der Verbannte von Tomi – nicht Herodot, Strabon oder Vergil im Skythenexkurs der Georgica (III,349-383) – ist derjenige antike Autor, der das ausführlichste und anschaulichste Bild vom realen Leben in der Dobrudscha, der Keimzelle des romanisierten Rumäniens geliefert hat, in kräftigen, wenn auch düsteren Farben.
Und: Ovid gilt den Rumänen als Begründer ihrer Nationalliteratur. Traditionelle spanische Literaturgeschichten beginnen mit Seneca (Córdoba), Martial (Calatayud), Lucan (Córdoba), Columella (Cádiz); die Verbindung Ovids mit Rumänien aber ist weitaus enger. Er war ja der Erste, der auf dem Boden des ,Römerlandes‘ (= România) auf ,Römisch‘ (românește) über Land und Leute dichtete, und so „un simbol al latinitaţii”, (1) ein Symbol der Latinität Rumäniens wurde. Ein dritter Grund: Rumänien ist Land des Exils und der Auswanderung.
Leben und Leiden am Schwarzen Meer
Augustus relegierte Ovid nach Tomi(s) ans Schwarze Meer („relegatus, non exul“, Tristia II, 137), aus Gründen die sich nicht präzisieren lassen; für das vorliegende Thema ist dieses Rätsel irrelevant. Weder Augustus noch sein Nachfolger Tiberius hob die relegatio auf.
Tomi(s) (Τόμοι, = Tŏmī, Tŏmōrum, oder Τόμις, = Tŏmĭs, Tŏmĭdĭs) lag an der Nordwestküste. Unter Konstantin I. wurde die Stadt zu Ehren seiner Halbschwester in Constantiana umbenannt, ein Name, den sie noch heute trägt: Constanța. Ein buntes Gemisch von Griechen, Geten, Sarmaten (skythischer Abstammung) und Römern (Militär, Verwaltungspersonal, Kaufleute) bildete die Bevölkerung. Man lebte von Landwirtschaft, Fischfang und Handel. Ionische
Siedler, aus Milet, hatten die Stadt in der Mitte des 7. Jahrhunderts auf einer kapähnlichen Halbinsel gegründet. Tomi besaß, unter römischer Oberhoheit, die übliche Selbstverwaltung der griechischen Polis. Das Hinterland, die Dobrudscha, war fruchtbar und lieferte Getreide. Gesichert wurde die Stadt – notdürftig – durch eine kleine Garnison. Das angrenzende Gebiet gehörte zu Thrakien, das den Status eines Klientelkönigtums Roms hatte, de facto aber unabhängig war. Das Territorium am Unterlauf der Donau bildete die von Makedonien aus verwaltete Provinz Moesia. Die Eroberung fast des ganzen Gebietes des heutigen Rumäniens vollzog sich unter Trajan, der den Daker-König Decebal besiegte.
Dem Weltstädter Ovid erschien Tomi als hinterwäldlerisch, als geistige Einöde, stets bedroht von feindlichen ,Barbaren‘. Seine Schilderung des Winters dort (Tristia III,10) huldigt gewiss Vergil, aber Ovid betont – kontrapunktisch –, dass er die Schrecken selbst erlebt hat (35-38 und 49-50): Stürme peitschen, alles ist eisverkrustet und schneebedeckt, Fische erstarren, Delphine rammen sich beim Springen den Schädel an der Eisdecke des Pontus.
„Ovidiu își exagerează, în versurile sale, starea mizeră, vrea să stârnească neapărat compasiunea și, în ultimă înstanţă, să obţină iertarea împăratului. Dar câteva împrejurări semnalate în mesajul său poetic sunt absolut verosimile: lipsa de influenţă reală și de putere a Romei în Scythia Minor (regiunea Dobrogei), înglobată în provincia romană Moesia încă din 28 î.Hr.; stagnarea procesului de romanizare, dacă nu chiar regresul acestuia, din moment ce chiar și grecii din colonii se getizau treptat; lipsa coloniștor romani sau latinofoni, care ar fi putut deveni vectorul romanizării.“ (2)
„Ovid übertreibt in seinen Versen seine Misere, er möchte unbedingt Mitgefühl erregen und, in letzter Instanz, die Begnadigung durch den Kaiser erreichen. Aber mehrere Umstände, die er in seiner dichterischen Botschaft mitteilt, sind absolut wahrscheinlich: das Fehlen echten Einflusses und echter Macht Roms in Scythia Minor (das Gebiet der Dobrudscha), das von 28 v. Chr. an der römischen Provinz Moesia einverleibt wurde; das Stagnieren des Prozesses der Romanisierung, wenn nicht sogar eine rückläufige Entwicklung, von dem Moment an, wo auch die Griechen unter den Kolonisten getisch wurden; das Fehlen von römischen Kolonisten, die der tragende Faktor der Romanisierung hätten sein können.“
Hier sei klargestellt: Der Begriff der ,Übertreibung‘ („Ovidiu își exagerează starea mizeră“), der in der Fachliteratur häufig in diesem Zusammenhang gewählt wird, ist unangemessen, denn alle Dichtung sagt Individuelles aus. Nach derselben ,Logik‘ könnte man etwa an einem impressionistischen Gemälde kritisieren, es „verzerre die Wirklichkeit”. Dass Ovid zugleich die Absicht verfolgte, seine Begnadigung zu erwirken, steht dazu in keinem Gegensatz.
Kommunikationsprobleme
Anfangs helfen nur einfachste Gebärden. Latein ist den Geten unverständlich. Er ist es, der hier Barbar ist, misstrauisch argwöhnt er daher Missachtung:
exercent illi sociae commercia linguae:
per gestum res est significanda mihi.
barbarus hic ego sum, qui non intellegor ulli,
et rident stolidi verba Latina Getae.
meque palam de me tuto male saepe loquuntur,
forsitan obiciunt exiliumque mihi. (Trist.,V,10,35-40)
Man vergleiche diese Verse mit dem, was uns der Schriftsteller Jean Améry in seinen Erinnerungen mitteilt, der vor den Nazis nach Belgien geflohen war:
„Denke ich zurück an die ersten Tage des Exils in Antwerpen, dann bleibt mir die Erinnerung eines Torkelns über schwanken Boden. […] Gesichter, Gesten, Kleider, Häuser, Worte (auch wenn ich sie halbwegs verstand) waren Sinneswirklichkeit, aber keine deutbaren Zeichen. […] Ich wankte durch eine Welt, deren Zeichen mir so uneinsichtig blieben wie die etruskische Schrift.“ (3)
Eine zweite Parallele: Die rumänischen Medien berichten von zahlreichen Fällen aus dem Ausland heimkehrender Frauen, die Heimatferne, Kommunikationsprobleme und Lebensbedingungen, in erster Linie in Italien, nicht mehr ertragen. Ihr Leid wird in Rumänien mit dem Begriff ,sindromul Italia‘ bezeichnet. Für sie ist die ersehnte Heimat Ovids unwirtliche Fremde, und ihre Heimat ist das Land seiner Verbannung.
Die sprachwissenschaftliche Forschung hat gezeigt, dass die großen Verständnisprobleme, die Ovid zu Anfang seines Aufenthaltes in Tomi hatte, darauf zurückzuführen waren, dass das Getische zwar eine indoeuropäische Sprache wie das Lateinische war, aber zu einem anderen Zweig der Sprachfamilie gehörte, nämlich, nach der traditionellen Einteilung, nicht zu den centum-Sprachen, sondern zu den satem-Sprachen. (4)
Später gelingt es Ovid, Getisch und Sarmatisch zu lernen: „Nam didici Getice Sarmaticeque loqui”, (Epist. III,2,40). Lautmalerisch ist dieser Vers, dem Wohlklang der genannten Idiome schmeichelt er wenig. Der Dichter hat, wie er uns gegen Ende der Epistulae mitteilt, auf Getisch sogar ein Gedicht über Augustus in lateinischen Versformen geschrieben, das bei den Zuhörern Anklang fand (Epist. IV,13,17-22); leider ist es verloren.
Die Verbannung – Fiktion?
Es ist, im deutschen Sprachraum vor allem von Heinz Hofmann, die These vertreten worden, die Verbannung sei fiktiv, ein literarisches Gestaltungsmittel also, und der Sprecher, Naso, eine Kunstfigur. Nicht eigener Anschauung entstammten die Schilderungen vom Pontus, sondern das Ergebnis von Quellennutzung seien sie. Der Verbannungsort Tomi sei unplausibel, da singulär. Es wird auf die Tatsache verwiesen, dass bei keinem anderen Autoren, auch nicht bei solchen, die ansonsten Ovid erwähnen, von dessen Verbannung die Rede ist. (5)
Ihre Verfechter tragen für diese ,dekonstruierende‘ Lektüre gegenüber der herkömmlichen die Beweislast. Die Argumentation vermag jedoch nicht zu überzeugen. Gegen sie spricht zunächst die autobiographische Präsenz des Dichters und seines faktischen Lebens in Italien in den beiden genannten Exil-Werken. Der da in beiden Gedichten zu uns spricht, ist nicht ein fiktives Ich, sondern eindeutig der zu Sulmo geborene Dichter der Metamorphosen und der Ars Amatoria. Hätte er zeitgleich das Leben auf den weichen Polstern Roms genossen, so hätten die Klagen über die Härten dieses hochkomfortablen Exils befremdlich hohl oder unfreiwillig komisch gewirkt.
Statisch hätte der Dichter sich für zwei komplette Werke auf denselben schwermütigen Grundton festgelegt. Dieselbe Fiktion hätte er auch im Ibis verwendet und in den Fasti, dort (IV, 82-84) sogar ohne thematische Erfordernis, in einem kurzen Exkurs. Aus freien Stücken hätte er sich, das Lob seines Peinigers Augustus singend, in die Rolle des ewig Flehenden versetzt. Die massive Häufung beider Elemente ist poetisch sowie im Hinblick auf die Textkohärenz funktionslos. Die nächstliegende Lesart: Ovids Anliegen ist real.
„Derartige Vorstellungen moderner Interpreten [gemeint ist die These, dass Ovid seine Verbannung und seine Erfahrungen in Tomi fingiert habe] haben bislang keinen Glauben gefunden. Es steht zu befürchten, dass Ovid, hätte er tatsächlich den alten Kaiser mit immer neuen Gedichten aus einem angeblich von diesem selbst herbeigeführten Exil genervt, vom Kaiser deswegen verbannt worden wäre – vielleicht auch nach Tomi.“ (6)
Dass er Topoi und Motive anderer aufgreift, sich mit Odysseus oder Aeneas vergleicht, erwarteten die Leser von ihm. Woher aber stammt die Eindringlichkeit der Schilderungen von Innen- und Aussenwelt, die gerade nicht papiern wirken, sondern den Stempel des Selbsterlebten tragen? Der beste Kronzeuge, Nicolae Lascu, früherer Präsident des Zentrums für Ovid-Studien an Ort und Stelle, in Constanţa, hat betont, Tristia III beruhe unmissverständlich auf realer Anschauung („vision directe”) Ovids und besitze ein hohes Maß an Dokumentationswert („valeur documentaire”) der leicht von der subjektiven Auswahl und Formung zu scheiden sei. (7)
Desweiteren: Die Verbannung ist zwar in keiner anderen von Ovid unabhängigen Quelle erwähnt, der Kunstgriff des fiktiven Exils aber auch nicht! Als Quintilian etwa Ovids ingenium rühmt (Inst. 10,1,98), spricht er davon mit keiner Silbe; Suetons De poetis ist uns nicht erhalten. Und: Ein heutzutage verschwundener graffito aus Herculaneum ist dokumentiert, der sich wahrscheinlich auf Ovids Tod in Tomi bezieht: [—]io morieris Tomi. Feliciter. (CIL 4.10595). (8)
Zwei Quellen helfen ebenfalls, Ovids Ibis und Tacitus‘ Dialogus de Oratoribus. Ibis (10/11 n. Chr.) ist nach Einfallsreichtum und mythologischen Kenntnissen unverwechselbar ovidianisch. (9) Die ungewohnte Bitterkeit dieses Schmähgedichtes (nach Kallimachos) gegen einen anonymen Feind lässt sich am besten autobiographisch erklären, als Resultat einer tiefen Erschütterung: „As at the beginning of the Tristia, Ovid dramatizes a forced break with his former self: a previously benign poet now seeks to wound.” (10) Zu Beginn (Ibis 1-30) thematisiert der Dichter selbst diesen Bruch mit seinem ganzen früheren Werk, der durch die Ausnutzung seiner Exilsituation durch einen falschen Freund bedingt sei.
In Tacitus‘ um 75 n. Chr. spielenden Dialogus de Oratoribus preist ein zum Dichter gewordener Redner, Curiatius Maternus, das Poetendasein gegenüber dem des Redners. Kein Rhetor könne es mit ,honor‘ und ,gloria‘ der großen Dichter aufnehmen. Unter den Beispielen, die er nennt, sind Vergil und Ovid. Der Ruhm von dessen (verlorengegangenem Theaterstück) Medea übertreffe den aller noch so guten Reden seiner Zeitgenossen (12,6). Dann liefert er ein anderes, naheliegendes Argument, die plausible Regel: der Dichter genieße „Sicherheit und Zurückgezogenheit“, „securum et quietum secessum“, das tägliche Brot des Redners aber sei Turbulenz und Konflikt („inquieta et anxia oratorum vita“) (13,1).
Als Beispiel für dieses Leben in unangefochtener Muße wählt er Vergil, der sich gleichermaßen der Gunst des Augustus und der Bewunderung durch seine Mitbürger erfreut habe. Gerade noch hat er Vergil und Ovid parallel, in einem Atemzug, genannt, aber jetzt bleibt jeder Hinweis auf Ovid aus. Einzig Vergil ist es, dessen konfliktfreies Leben gerühmt wird. Wenn Ovids Exil fiktiv wäre, dann hätte sich genau jetzt ein Hinweis darauf angeboten, aber hier fällt sein Name nicht. Er passte nicht in die Argumentation für die Geborgenheit des Poetenlebens.
Ovids Rezeption in Rumänien
Am Anfang der Ovid-Rezeption in Rumänien (11) steht das Werk des siebenbürgischen Adligen Valentin Franck von Franckenstein (1643-1697), ein polyglottes Meisterwerk des Barock, Hecatombe sententiarum Ovidianarum germanice imitatarum (Hermannstadt 1679), das Übertragungen und freie Nachahmungen von Ovid-Sentenzen ins Hochdeutsche, ins Magyarische, Rumänische und Siebenbürgisch-Sächsische enthält.
Nachdem Archäologen Ende des 19. Jahrhunderts die Identität von Tomi mit Constanța
bewiesen hatten, war Ovid en vogue. Eine neue Literaturzeitschrift mit dem Namen Ovidiu erschien 1898 in Constanța, in deren erster Nummer ein schwermütiges Gedicht von Petre Vulcan mit dem Titel „Ovidiu în exiliu” veröffentlicht wurde, das aus einer Haltung des Mitgefühls heraus, auf der Basis der Tristia, Ovids Leiden vom Abschied „de-al Romei dulce sân”, „von der süßen Brust Roms”, bis zum Tod im Exil schildert.
Vasile Alecsandri (1821-1890) und Georg Scherg (1917-2002) schrieben Ovid-Dramen. Alecsandris Stück Ovidiu beschreibt ein Liebesverhältnis zwischen Augustus‘ Enkelin Julia und dem Dichter, das dem Kaiser von der eifersüchtigen Corinna und dem Intriganten Ibis (dem Sujet des gleichnamigen Ovid-Gedichtes) hinterbracht wird und dessentwegen beide Liebenden verbannt werden. Julia gelangt schließlich nach Tomi und will Ovid die Nachricht von seiner Begnadigung überbringen, findet ihn aber auf dem Sterbebett vor. In Georg Schergs gleichnamigen Drama (1955) dagegen steckt die in allem skrupellose Livia, Augustus‘ intrigante Gattin, die den Thron für Tiberius zu sichern versucht, hinter der Verbannung des ihr verhassten Dichters. Als Augustus Ovid begnadigen will, wird er von Livia vergiftet. Keines der beiden Stücke, in denen Palastintrigen dramatisiert werden, zu deren Spielball und Opfer Ovid wird, hat außerhalb Rumäniens nennenswerten Anklang gefunden.
Dichter des Exils
1960 sorgte dagegen ein Ovidroman in Europa für eine Kontroverse, Dieu est né en exil. (12) Der Autor, ein ,Newcomer‘, der Rumäne Vintilă Horia (eigentl. Vintilă Caftangioglu) (1915-1992), hatte sein Buch auf Französisch verfasst, so wie viele rumänische Intellektuelle sich dieser Sprache bedienen; man denke an Mircea Eliade und Emil Cioran. Horia erhielt 1960 für seinen Roman, ein fiktives Tagebuch Ovids während der Verbannung, den renommiertesten französischen Literaturpreis, den Prix Goncourt.
Das löste Proteste aus, denn der Exilant Horia war mit scharfer Kritik an der kommunistischen Diktatur in seiner Heimat hervorgetreten. Wie zu erwarten, diffamierte ihn die rumänische Staatspropaganda – unterstützt von westlichen Linken – als ,Faschisten’. Richtig daran war, dass Horia sich in Jugendjahren zu Sympathien für den italienischen Faschismus verirrt hatte. So wie zur selben Zeit, in den Wirrnissen der zwanziger und dreißiger Jahre, die bekanntesten europäischen Linksintellektuellen – ausnahmslos – für den Stalinismus Partei ergriffen, viele von ihnen in absurden Formen der Adulation. (13) Was jedoch die Propaganda nicht übertönen konnte: Horia hatte sich von seiner früheren Haltung distanziert, war 1944/45 von den Nationalsozialisten im KZ festgehalten, von britischen Truppen befreit worden. Der Faschismusvorwurf verfing also nicht richtig. Der Angriff auf den Roman, der nichts ,Faschistisches’ enthält, ja dessen Grundideen in diametralem Gegensatz zur faschistischen Ideologie stehen, wurde daher auch auf einer anderen Ebene geführt: Ein mediokres Produkt eines mediokren Autors sei er, des hehren Preises unwürdig.
So veröffentlichte etwa Der Spiegel, bevor das Werk überhaupt auf Deutsch erschienen war, einen höhnisch-herablassenden Artikel mit dem Titel „Ovids Metamorphose“ (14), der Buch und Autor den nötigen literarischen Rang absprach. Im Substantiellen ist der Artikel wenig ergiebig, in den Details teilweise verdächtig irreführend, so dass sich ein böser Verdacht einstellt: Mit der Lektüre des Buchs dürfte sich der (anonyme) Skribent gar nicht erst aufgehalten haben.
Die Kontroverse ist Vergangenheit; angesichts der Kritik, die ihm entgegenschlug, lehnte der Autor es ab, den Preis entgegenzunehmen. Was bleibt, ist Horias Roman. Dass das Schicksal des Ovid ihn packte und nicht mehr losließ, ist unschwer nachzuvollziehen. Beide wurden ja von Herrschenden in die Fremde verjagt, in einander entgegengesetzte Richtungen. Horia stammte aus Segarcea im Süden Rumäniens; nach dem Krieg lebte er bis zu seinem Tod im Exil, zuerst in Italien, dann in verschiedenen anderen Ländern. Er starb in Spanien.
Der rumäniendeutsche Schriftsteller Richard Wagner hat vor ein paar Jahren Horias Ideenreichtum bei der Behandlung „des Exils als Existenzform“ hervorgehoben. (15) Horia selbst hat die Trennung von Freunden und Bekannten, das Gefühl der Entfremdung genauso durchlitten wie Ovid. In einem Interview sagte er: (16)
„M-am simţit atunci, mai mult ca înainte, autorul propriului meu roman, în sensul că Ovidiu lua proportii nebănuite. Eu mă transferam în timpul lui Augustus, și Ovidiu în cel al lui Stalin.“ – „Ich fühlte mich
damals, viel mehr als zuvor, als Autor meines eigenen Romans, in dem Sinne, dass Ovid ungeahnte Proportionen annahm. Ich trat in die Zeit des Augustus über, und Ovid in die Stalins.“
Augustus – im faschistischen Italien zur imperialen Lichtgestalt verklärt – ist bei Vintilă Horia bloßer Tyrann. Sein Ovid macht den Alleinherrscher dafür verantwortlich, dass die Freiheit in Rom und im ganzen Reich ausgelöscht sei, etwa durch die Zensur, von der er selbst betroffen ist. Der Vorwurf: Ovids Werke seien moral- und jugendgefährdend. Er sieht sich gezwungen, schmeichelnd und anbiedernd von dem verhassten Machthaber die Begnadigung zu erflehen.
Jeder Gedanke Ovids gilt seinem Leben in Rom und seiner Geburtsstadt in einem Abruzzental, Sulmo (S.18f.): „Ich bin seit etwa zehn Tagen hier; vor drei Monaten habe ich Rom verlassen, aber ich bin in Rom.” Zu Beginn des zweiten Jahres im Exil schreibt er in sein Tagebuch:
„Nächstes Jahr werde ich in Rom sein, schon seit Monaten. Augustus wird sicher tot sein, meine Bücher werden wieder in allen Bibliotheken stehen, und ich werde in den Thermen oder bei mir zu Hause, am Kamin, die Taten der Medea erzählen.“ (S. 47)
Im sechsten Jahr dagegen: „Ich habe viel an Rom gedacht, in den letzten Tagen. Aber ohne Heimweh.“ (S. 208) Und im siebten: „Ich werde unter den Geten sterben, ich weiß es.“ (S. 219).
Langsam verblassen seine Erinnerungen, die Kontakte zu den Freunden werden schwächer, ihn erfüllt die Sorge um den Verfall seiner Sprache.
Der Roman ist in acht Kapitel gegliedert, die jeweils einem Jahr entsprechen, und einem Zuwachs an Reife. Nach und nach wird Tomi ihm zur Heimat. Ovid fügt sich in das neue Leben ein, er schließt Freund- und Bekanntschaften dort und an anderen Orten des Schwarzen Meers, wird Teil des Lebens in der Provinzstadt, wird in eine Kriminalgeschichte verwickelt. Auf seinen Reisen dringt der stets Neugierige, Wissensdurstige, tief in dakische Kultur und Lebensart ein, lässt die Arroganz dessen hinter sich, der zuvor im Nabel der Welt gelebt hatte.
Es kommt der Augenblick, da er dem Tagebuch anvertraut: in Rom wolle er am liebsten den Winter verbringen, den Rest des Jahres in Tomi. (S.126) Die Vorstellung einer Synthese von Römern und Dakern, „une nouvelle forme humaine“, begeistert ihn. Er sieht die Vereinigung von Römern und Dakern voraus: die Rumänen. Sie werden, so hofft er, die besten Eigenschaften beider Seiten in sich vereinigen. (S. 221)
Der Roman hat jedoch eine weitere Dimension. Die Welt der Mythen und Götter ist zwar stets präsent, die Geschichten der Metamorphosen sind von Horia kunstvoll in die Reflexionen des Protagonisten eingeflochten. Den Glauben an die Realität des Götterhimmels aber hat dieser längst verloren. Manfred Fuhrmann hat die Haltung des realen Ovid so beschrieben: (17)
„Ovids Götter handeln oft ungerecht und grausam, weil sie gar keine Götter mehr sind, sondern Zeichen für irdische Machthaber. Ovids illusionsloses, um nicht zu sagen nihilistisches Weltbild war schlechthin unvereinbar mit der Doktrin des augusteischen Staates, und ebendeshalb traf ihn der Bannstrahl des Kaisers nicht von ungefähr.“
Horias Ovid ist ein Gottsucher. Seine Geliebte Corinna hatte ihm gestanden, sie verehre Isis.
„Ces jours-là, je demeurais seul, vraiment seul et je cherchais aussi un temple, un culte, n’importe quoi, pour croire à quelque chose et supporter ma solitude. Mais je ne trouvai rien. J’écrivis beaucoup. Mais ces vers ne me donnaient que la gloire.“ (S.89) – „In jenen Tagen blieb ich allein, wirklich allein, und auch ich suchte einen Tempel, einen Kult, egal was, um an irgendetwas zu glauben und meine Einsamkeit ertragen zu können. Aber ich fand nichts. Ich schrieb viel. Aber diese Verse brachten mir nichts ein als Ruhm.“
Das Glaubensthema ist von den ersten Seiten des Romans an präsent, in Reflexionen, Vorahnungen und Träumen, denn der Dichter fühlt sich vom Monotheismus der Geten herausgefordert. Schließlich bringt ihm ein griechischer Arzt, Theodoros, der im Orient tätig gewesen war, die Nachricht von der Geburt des Messias in Bethlehem. Im sechsten Jahr der Verbannung äußert Ovid: „Et je sais que Dieu est né, Lui aussi, en exil.“ (S. 207f.) – „Und ich weiß, dass Gott, auch Er, im Exil geboren ist.“ Die Selbstbehauptung gegen gesellschaftlichen und staatlichen Zwang, die Erfahrung der Ohnmacht gegenüber den Mächtigen, das
(Über-) Leben im Exil, die Suche nach dem unbekannten Gott – das sind Themen, die nichts an Dringlichkeit eingebüßt haben.
Literatur:
Améry, Jean (1977): Schuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines Überwältigten, Stuttgart.
Anon., Ovids Metamorphose (1960), Der Spiegel Heft 49/1960 vom 30.11.1960; zitiert nach dem Spiegel Online-Archiv, aufgerufen am 10. 9. 2019.
Frampton, S. A. (2019): Empire of Letters: Writing in Roman Literature and Thought from Lucretius to Ovid, Oxford.
Fuhrmann, M. (1991): Streit um Fortunas Schuld, Rezension zu M. Giebel, Ovid, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5.11.1991, S. 34.
Hofmann, H. (2001): Ovid im Exil? … sumque argumenti conditor ipse mei – Ovids Exildichtung zwischen Biographie und Fiktion, Latein und Griechisch in Baden-Württemberg – Mitteilungen 29 (2001), Heft 2, S. 8-19.
Hofmann, H. (2009): Der römische Dandy am Ende der Welt, in: Neue Zürcher Zeitung, 10. 1. 2009, Internet-Version aufgerufen am 26. 1. 2021.
Horia, V. (1988) (1960): Dieu est né en exil: journal de Ovide à Tomes, Paris.
Horia, V. (1991): VINTILĂ HORIA ,Gândesc în limba română, azi, ca și întotdeauna’; aufgerufen am 9. 9. 2019;
Interview vom September 1991 mit Angela Martin, zitiert nach der Internetseite Cultura,
www.revistacultura.ro; Nr. 40, 21.9.2006.
Hornblower, S., Spawforth, A. (1998), The Oxford Companion to Classical Civilization, Oxford 2014 (1998).
Lascu, N., Ovide (o.J.): Le poete exilé à Tomi, Archäologisches Museum Constanța.
Petersmann, G. (2007), Ovids Exildichtungen sind der Beginn einer rumänischen Literatur, in: Aurora, Zeitschrift für Kultur, Wissen und Gesellschaft, Interview mit F. Wagner, 1. 3. 2007, Internet-Version aufger. am 26.1.2021.
Pop, I.-A. (2019), De la romani la români. Pledoarie pentru latinitate. Bukarest.
Wagner, R. (2007): Ein Schriftsteller im Kalten Krieg, in: Neue Zürcher Zeitung, 2. 4. 2007; zitiert nach dem Archiv der NZZ, aufgerufen am 10. 9. 2019.
Wurm, C. (2013): Ein Platz an der Sonne? – Die Civitas Solis des Tommaso Campanella, Forum Classicum 1/2013, S. 39-45.
Ziolkowski, Th. (2005): Ovid and the Moderns, Ithaka/London.
Anmerkungen:
- Pop 2019, S. 122.
- Ebd., S. 117f.
- Améry 1977, S. 65.
- Pop 2019, S. 123.
- Vgl. Hofmann 2001, S. 8-19 und die Kurzfassung 2009
- Petersmann 2007
- Lascu, o. J., S. 80
- Frampton, Empire of Letters: Writing in Roman Literature and Thought from Lucretius to Ovid 2019, S. 161. Die Autorin hat vor Ort die Stelle der früheren Inschrift inspiziert. Feliciter ist von zweiter Hand hinzugefügt.
- Hornblower 2014 (1998), S. 564.
- Ebd. Die beiden Hervorhebungen sind von mir.
- Das Thema ist ausführlich dargestellt in Ziolkowski 2005, Kap. II,7
- Alle Zitate entstammen der Ausgabe Dieu est né en exil: journal de Ovide à Tomes, Paris 1988 (1960). Die Übersetzungen sind von mir.
- Vgl. Wurm 2013, S. 39-45; hier: S. 43f.
- Heft 49/1960 vom 30.11.1960; zitiert nach dem Spiegel Online-Archiv, aufger. am 10. 9. 2019.
- Wagner 2007.
- VINTILĂ HORIA 1991; ich habe die fehlenden rumänischen Schriftzeichen eingefügt.
- Fuhrmann, 1991, S. 34.
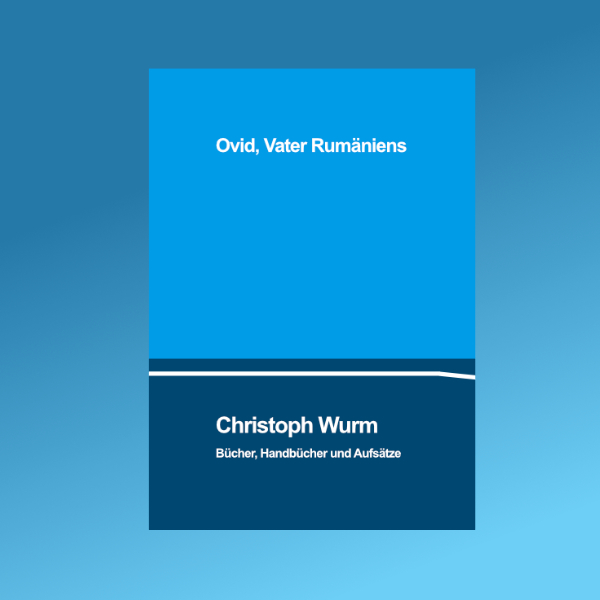
Dieses Dokument stelle ich Ihnen gerne kostenlos als PDF Dokument zum download. Um dieses Dokument herunterzuladen klicken Sie bitte auf den nachfolgenden Button.