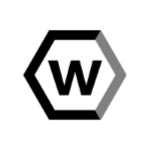Mönche auf Indianerpfad
Zu den Grundpfeilern der Halbbildung gehört die Vorstellung, die Naturwissenschaftler hätten, als sie seit der Aufklärung, also seit dem 18. Jahrhundert, die Fackel der Vernunft in die Welt hinaustrugen, glorreich den finsteren Widerstand von Kirche und Religion niedergerungen. Sie – so wissen es der gestandene ,Spiegel’-Leser, die ,Stern’-Abonnentin – waren die Sachwalter der Vernunft, „die Kirche“ dagegen Hort dunkler Ignoranz. Nicht Päpsten, nicht Märtyrern noch Heiligen gilt die Bewunderung dieser sich im Bilde Wähnenden – sondern Charles Darwin.
Was von diesem Tableau aus Licht und Schatten zu halten ist, sei an einem Beispiel illustriert. Es gehört sowohl in die Religionsgeschichte als auch in die der Philologie.
Als die Spanier weite Teile Amerikas eroberten, stand vom ersten Augenblick an die Christianisierung der Ureinwohner auf ihrem Programm. Missionare folgten den Eroberern, und sie sahen sich wie diese einem gewaltigen Kommunikationsproblem gegenüber: Wie sollten sie sich mit den Einheimischen verständigen?
Die Antwort, die darauf von der spanischen Krone gegeben wurde, war bemerkenswert: Die Missionare sollten sich, so schwer es auch sein mochte, in die einheimischen Sprachen einarbeiten und die Glaubensinhalte in ihnen vermitteln. Keinesfalls sollte der Gebrauch des Spanischen durchgesetzt werden.
Philipp II. dekretierte: „No parece conveniente forzarlos a abandonar su lengua natural: solo habrá que disponer de unos maestros para los que quisieran aprender, voluntariamente, nuestro idioma.“ – „Es erscheint unangemessen, sie zu zwingen, ihre Muttersprache aufzugeben. Es sollen nur für diejenigen einige Lehrer vorhanden sein, die eventuell freiwillig unsere Sprache lernen möchten.“
Den Sprachen der Ureinwohner wurde höchster Respekt gezollt (nicht nur in Amerika, sondern auch auf den Philippinen). So wurde bereits 1596 an der Universität von Lima ein Lehrstuhl für die Sprache der Anden eingerichtet: die bis heute gesprochene Inka-Sprache Quechua.
Ein mühseliger Arbeitsprozess begann, denn es galt ja nicht nur, Grammatik und Vokabular der genannten Sprachen systematisch zu erfassen und schriftlich zu fixieren, was zuvor nie geschehen war, sondern neue sprachliche Formen für die Inhalte des Glaubens zu schaffen. Begriffe wie ,Gnade‘, ,Glaube‘, ,Sühne‘ fehlten.
Mit Bravour wurde sie bewältigt, diese immense philologisch-theologische Herausforderung. Lexika und Grammatiken der indigenen Sprachen entstanden, lateinische und spanische Texte wurden übersetzt, und zwar nicht nur in Lateinamerika, sondern auch im Norden. Bereits die ersten französischen Missionare in Kanada erkannten, wie wichtig es war, die Sprachen der Ureinwohner zu erlernen. Die legendären Patres Brébeuf und Sagard, philologische Hochbegabungen, dokumentierten Anfang des 17. Jahrhunderts die Sprache der Montagnais-Indianer und der Huronen. Brébeuf forderte, die Huronensprache solle der „Heilige Thomas und der Aristoteles“ der Missionare werden.
Eine brutale Gegenbewegung der Gleichmacherei und des Zwangs setzte erst im 19. Jahrhundert ein, nämlich als die spanischen Kolonien eine nach der anderen unabhängig wurden. (Ein Prozess, der mit der Unabhängigkeit von Kuba und Puerto Rico 1898 endete).
Die neue Oberschicht, die sich vom Mutterland distanzierte, orientierte sich an den Idealen der Französischen Revolution. Eine große Rolle spielten die Freimaurerlogen, die dezidiert antikirchlich orientiert waren. Die neuen Herren sahen sich als Sachwalter des Fortschritts, und die indigenen Kulturen und Sprachen galten ihnen als minderwertig. Sie gingen daran, sie auszurotten.
Man muss diese zerstörerischen Tendenzen in die Geistesgeschichte der Zeit einordnen. Im 19. Jahrhundert entwickelten sich – Seite an Seite, leider häufig auch Hand in Hand, mit den Naturwissenschaften – einflussreiche rassistische Theorien. Ihren unheilvollen Einfluss sollten sie, wie wir alle wissen, im folgenden Jahrhundert potenzieren.
Autoren wie Arthur de Gobineau (1816 – 1882) und Houston Stewart Chamberlain (1855 – 1927) propagierten die Überlegenheit der weißen Rasse und die Notwendigkeit, sie „rein“ zu halten, und solche Ideen schwappten nach Amerika herüber.
Ein übler Rassist dieser Zeit war kein Geringerer als jener oben erwähnte Fackelträger, jene Portalfigur des Fortschritts: Charles Darwin. Er gehörte zu dem gerade auch in unseren Tagen anzutreffenden Typus des Naturwissenschaftlers, der in seinem Feld brilliant ist – jenseits des Tellerrands aber nicht frei von Borniertheit.
Darwins Forschungsreisen mit der Beagle häuften naturwissenschaftliche Erkenntnisse an, zugleich aber propagierte er die schlimmsten rassistischen Vorurteile. Als Ende des 19. Jahrhunderts der fürchterliche Völkermord an den Ureinwohnern Feuerlands stattfand, dienten seine Pöbeleien als Rechtfertigung. Denn er, der 1834 mit der Beagle Kap Hoorn umsegelt hatte, hatte die Feuerländer als kulturlos, als leibhaftige Affenmenschen, als die verächtlichsten Geschöpfe beschrieben, die er jemals getroffen habe. Das Anthropologische Museum in London bezahlte acht Pfund für den Kopf eines Feuerländers, worauf Killerkommandos zur Jagd nach Beute aufbrachen.
Mit Darwin vergleiche man einen Zeitgenossen. Einen bescheidenen Pater, der als frommer Augustinermönch den Namen Gregor führte. In der Stille des Klostergartens zu Brünn widmete er sich naturwissenschaftlichen Studien, die zu seinen Lebzeiten nie richtig gewürdigt wurden: Was sollte man in der Welt des Fortschritts von den botanischen Bemühungen eines Mönches schon erwarten!
Sein Name: Johann Mendel (1822-1884), der Begründer der Genetik.