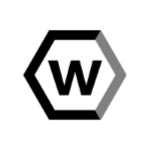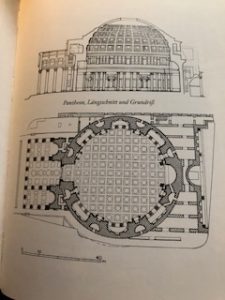Schuld & Lust, Stolz & Holz
Das Zerrbild der deutschen Kaiserzeit, das viele im Hinterkopf mit sich herumtragen, hat mich nie überzeugt: das eines militaristischen Obrigkeitsstaats, einer Art Nord-Vietnam unter Wilhelm II. als Kim Jong-un mit Pickelhaube. Dass sich in jüngster Zeit in der historischen Fachwissenschaft ein ganz anderes, facettenreiches Bild Bahn bricht, nehme ich gerne zur Kenntnis.
Erst vor ein paar Wochen etwa erschien in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung unter dem Titel „Wir Untertanen“ ein Artikel1 der Historikerin Hedwig Richter, den die Autorin mit folgender Zusammenfassung einleitet: „Das deutsche Kaiserreich war um 1900 ein Laboratorium des demokratischen Aufbruchs. Trotzdem hält sich in Öffentlichkeit und Wissenschaft die Legende vom deutschen Sonderweg, einem Land unter der Pickelhaube.“
Dass das Dogma vom Sonderweg ein ziemlicher Holzweg war, hatte bereits im Jahre 2000 die kalifornische Professorin Margaret Lavinia Anderson in ihrem Buch Practicing Democracy: Elections and Political Culture in Imperial Germany nachgewiesen.
Detailliert belegt der Historiker Frank-Lothar Kroll in seinem 2013 erschienenen Werk Geburt der Moderne – Politik, Gesellschaft und Kultur vor dem Ersten Weltkrieg2, dass die Kaiserzeit mehr zu bieten hatte als Marschmusik und Pickelhaube. Er fordert eine „längst überfällige Neubewertung des wilhelminischen Deutschlands.“
Richter: „Was war das für eine Zeit! Plötzlich hatte sich ,in ganz Europa ein beflügelndes Fieber erhoben’, wie Robert Musil über die Jahre um 1900 notierte, ,überall standen Menschen auf, um gegen das Alte zu kämpfen.’ Frauenbewegung, Sozial- und Arbeitsreform, Wandervögel und Technikeuphorie – die Welt war in Bewegung. (…) Eine reformbegeisterte Zivilgesellschaft vibrierte im Fortschrittsglauben – wie im ganzen nordatlantischen Raum.“
Das deutsche Reich – so Kroll – sei um die Jahrhundertwende einer der fortschrittlichsten Staaten Europas gewesen, gerade etwa im Vergleich zu dem seit 1911 sogar von bürgerkriegsähnlichen Unruhen erschütterten Großbritannien. Die Kaiserzeit habe größte soziale, wissenschaftliche, künstlerischer Errungenschaften hervorgebracht.
Genau hier lag immer der Hauptgrund für mein eigenes Misstrauen gegenüber jenem trostlosen Negativbild: Wer Sprachen studiert, wird sehr bald merken, dass es in der Neuzeit nie vor oder nach dieser Epoche eine solche Blüte der Philologie gegeben hat wie damals in Deutschland.
Noch heute gilt die Faustregel: Wer nach einem besonders hieb- und stichfesten Hilfsmittel für irgendeinen Spezialbereich aus dem Feld der Sprachen sucht, egal für welchen, ist mit Werken des 19. und frühen 20. Jahrhunderts immer gut bedient. In vielen Fällen fehlt jede moderne Alternative – schon gar nicht seitens der immer dünnblütigeren Hochschulphilologie der letzten Jahrzehnte, die nur noch sich selbst wahrzunehmen scheint, und das unscharf.
Das ganze 19. Jahrhundert hindurch, vor allem aber nach der Gründung des Deutschen Reichs, erschienen unzählige Werke zu Sprache und Sprachen, die deutsche Geisteswissenschaft war weltführend. Wie sollen sich Weltoffenheit, Lernbereitschaft, Aufgeschlossenheit gegenüber fremden Kulturen unmissverständlicher manifestieren?
Ob Grammatiken des Baskischen oder des Chinesischen, ob ein Italienisch-Handbuch für Opernliebhaber3, ob ein Wörterbuch zu den Werken des Cervantes oder eine vergleichende Sammlung aller europäischen Sprichwörter: Werke dieser Art – stets hochwertig, leidenschaftlich akkurat – sind Zeugnisse der damaligen Blütezeit deutscher Wissenschaft.
Die heute vorliegenden Langenscheidt-Lexika für Latein und Griechisch aller Formate gehen auf Hermann Menge zurück, einen Philologen der Kaiserzeit. Dass bis heute das Französische im deutschen Sprachraum diejenige der romanischen Sprachen ist, die grammatikalisch und lexikalisch am differenziertesten dokumentiert ist, hat seine Ursache ebenfalls in der Kaiserzeit, als Französisch erste moderne Fremdsprache am Gymnasium war. Man denke etwa an Fritz Strohmeyer (1869 – 1957), dessen Französische Sprachlehre später von Hans-Wilhelm Klein überarbeitet wurde und als ,der Klein-Strohmeyer’ über Jahrzehnte hinweg ein Standardwerk blieb.
Im Vorfeld des Gedenkens an die erste große europäische Katastrophe des zwanzigsten Jahrhunderts, den Weltkrieg 1914 – 1918, ertönte in der Geschichtswissenschaft ein Paukenschlag, der bis jetzt noch nachhallt. Was war geschehen? Der australische Historiker Christopher Clark hatte sein minutiös dokumentiertes Werk The Sleepwalkers (2012), deutscher Titel: Die Schlafwandler, veröffentlicht, in dem er der These von Deutschlands Hauptschuld an diesem Völkerkonflikt eine klare Absage erteilt.
In dem umfangreichen Werk wies er nach, dass weder das deutsche Reich noch das verbündete Österreich-Ungarn die Schurken in diesem Stück gewesen seien, sondern dass sich die Kriegsursachen weitaus gleichmäßiger verteilten.
So also ein australischer Gelehrter, der heute in Cambridge lehrt, jemand der von seiner Provenienz her gewiss als ,disinterested’, als unvoreingenommen, einzuordnen ist.
In welchem Land stieß das Buch, ein internationaler Bestseller, auf den heftigsten Widerstand? – Richtig, in Deutschland. Clark zeigte sich in Interviews darüber erstaunt. Nirgendwo auf der Welt bestehe man so widerborstig auf vermeintlicher Schuld des eigenen Landes, lasse sich die Lust an ihr durch keine sachliche Argumentation vermasseln.
Ein wichtiger Grund für diese Fixiertheit ist der Einfluss der ,SPD-Historiker’. Ob Hans-Ulrich Wehler – in vorderster Linie gegen Clark –, Heinrich-August Winkler, Fritz Fischer oder Wolfgang Mommsen – gerade die einflussreichsten Historiker der Bonner Republik standen der SPD nahe oder waren sogar Parteimitglieder.
Wer aber politisch so festgelegt ist, wird ,Partei ergreifen’, wenn er jene Jahre ab 1871 untersucht, in denen die 1863 in Gotha gegründete SPD schwere Kämpfe auszufechten hatte. Er wird Schwierigkeiten haben, das wilhelminische Deutschland objektiver zu beurteilen. Die Genannten sind natürlich die bis heute in den Medien präsenten Deuter und Ankläger der wilhelminischen Zeit.
Zur Einschwärzung der Kaiserzeit bemerkt Frank-Lothar Kroll: „Die Geschichte des Bismarckreiches wurde mehr oder weniger als eine bloße Vorgeschichte des ,Dritten Reiches’ interpretiert. Sich als ,kritisch’ gebärdende Repräsentanten einer Historischen Sozialwissenschaft, allen voran Hans-Ulrich Wehler, überboten sich in ihrem Bemühen, entsprechende Kontinuitätszusammenhänge zu konstruieren und gegenläufige Forschungsmeinungen (…) nach Kräften zu delegitimieren.“
Zeit für eine Neubesinnung also, Zeit, unsern Vorfahren jetzt Gerechtigkeit widerfahren zu lassen!
1 Am 22. Juni 2018. Die Seite aufgerufen am 22.6.
2 be.bra Verlag, Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert Band I. Alle Zitate auf S. 8
3 Joseph Schlett, Selbstunterricht zum Verstehen italienischer Operngedichte als Vorschule zur vollständigen Erlernung dieser Sprache, Sulzbach 1823. – Ich habe das Buch nicht gekauft, weil ich ein großer Opernliebhaber wäre, sondern weil die Erklärungen Bereiche ausleuchten, die in heutigen Grammatiken des Italienischen gar nicht erwähnt werden oder zumindest nicht so übersichtlich zusammengefasst sind.